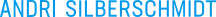Die Aufarbeitung der Corona-Krise löst wegen des Streits unter Epidemiologen erste Misstöne aus. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Parlaments beginnt mit der Aufarbeitung der Corona-Massnahmen.
Wer hat Recht gehabt, wer nicht? Der Streit zwischen Experten und dem Bundesamt für Gesundheit eskalierte am Wochenende. Obwohl die Schweiz rückblickend – trotz unzureichender Vorbereitung – die Corona-Krise bislang gut meisterte, macht sich ein fahler Beigeschmack breit.
Grund sind Aufarbeitungen der Krise, die die «NZZ am Sonntag» und das «Magazin» in den vergangen Tagen veröffentlicht hatten. So sollen die Behörden die Warnungen der Epidemiologie ignoriert haben. Die Kritik richtet sich allen voran gegen Daniel Koch, Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten» des Bundesamts für Gesundheits, und gegen Bundesrat Alain Berset in der Funktion als Gesundheitsminister. Zwischen den Zeilen las sich die Kritik gar wie ein Lügenvorwurf.
Flut an Briefen wegen Corona-Krise im Bundeshaus
Das bemerkte man auch im Parlament. Zu einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) – der «schärfsten Waffe» in Krisenfällen – kommt es zwar voraussichtlich nicht. Es kommt aber zu einer «Inspektion», durchgeführt durch die GPK von National- und Ständerat.
Die Arbeit ist immens und wurde auf mehrere Gruppen verteilt. Diese sogenannten «Subkommissionen» untersuchen nun Bundesratsdepartement für Bundesratsdepartement, stellen Fragen, bestellen Dokumente und bewerten diese. Ziel ist ein Bericht, der das gesamte Handeln der Behörden durchleuchten soll.
Das könnte Monate dauern, sagt GPK-Präsident und SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal zu watson: «Eine seriöse Abklärung benötigt Zeit.» Am 24. Juni wird über das weitere Vorgehen diskutiert.about:blankhttps://acdn.adnxs.com/dmp/async_usersync.html
Denn die Frage, wer hat wann, wie und wo Stellung genommen, ist delikat. Es ist die Frage nach dem «Helden» der Krise. Weil ein solcher Ruhm erstrückblickend verdient oder unverdient sein könnte, dürfte sich die GPK vor einer solchen Bewertung scheuen. So erinnert sich CVP-Präsident und Nationalrat Gerhard Pfister in der SRF-Sendung «Einfach Politik», dass während der Krise «sehr viele Briefe mit unterschiedlicher Qualität» an Bundesrat und Parlament verschickt wurden.
Die «unterschiedliche Qualität» zeigt sich rückblickend gut auch bei den lautesten Pandemie-Warnern hierzulande. EPFL-Professor Marcel Salathé, der sich über zögerndes Handeln des Bundesrates öffentlich ärgerte, sah Ende Februar in der «Republik» seiner geplanten Italienreise im April «relaxt» entgegen. Wochen danach waren die Grenzen zu Italien zu, das Land meldete Mitte April täglich rund 3500 Neuinfektionen.
Salathés Vorpreschen passt nicht allen
Im Parlament erwartet kaum einer, dass bei Krisen von solcher Dimension alles fehlerfrei abläuft. FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt, selbst Mitglied der GPK, sagt dazu: «Wer ‹Corona-Held› ist und wer nicht, ist jetzt unwichtig. Wir sollten die richtigen Schlüsse und Lehren aus der Krise ziehen, statt ‹hinten herum› zu kritisieren.»
Und letzteres habe Salathé gemacht, hört man vorwurfsvoll von Gesundheitspolitikern. Silberschmidt bestätigt, dass Salathés Eingreifen bei der Gesetzgebung zur Proximity-App nicht überall gut ankam. Der EPFL-Professor verschickte im Namen mehrerer Personen der Arbeitsgruppe «Contact Tracing und Quarantäne» und der «Swiss National COVID-19 Science Task Force» ein Mail an rund 40 National- und Ständeräte. Die Mails und Anträge liegen watson vor.about:blank
Darin wurde nicht nur für Änderungen zum Proximity-Tracing-Gesetz geweibelt, sondern auch vorformulierte Anträge mitgeschickt. Dieses Vorgehen gilt in der Schweizer Politik als unanständig. In der Gesundheitskommission kam das so an, als habe Salathé die Sicht der Experten «durchboxen» wollen, nachdem er offenbar beim Bundesrat abblitzte.
Salathé glättet die Wogen – Althaus will Aufarbeitung durch GPK
Das Beispiel mit dem missglücktem Lobbying-Versuch Salathés zeigt, dass Wissenschaft und Politik nicht immer dieselbe Sprache sprechen. Und dass aus einem ungelesenen, vergessenen, ignorierten oder missachtetem Warnbrief schnell der Vorwurf aufkommt, dass nicht die Wahrheit gesagt wird.
Am Tag, nachdem der Epidemiologen-Zoff entbrannte, versuchte der EPFL-Professor denn auch die Gemüter zu beruhigen. Salathé twitterte, dass er mittlerweile die Zusammenarbeit mit dem BAG als «sehr gut» beurteile und sein Vertrauen in die Politik hoch sei.
Christian Althaus, ebenfalls ein renommierter Epidemiologe und Mitunterzeichner eines Warnbriefs an den Bundesrat, blieb bei seiner Kritik.
«Dass in der Schweiz ehemalige Behördenvertreter über die Medien versuchen Wissenschaftler zu diskreditieren ist befremdend. Ich erwarte, dass diese Vorkommnisse von der GPK gründlich aufgearbeitet werden», so Althaus – ebenfalls auf Twitter. Mit erwähnt im Tweet war die Grüne Ständerätin und GPK-Mitglied Maya Graf, die sich für den «Input» für die Inspektion bedankte.