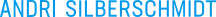Zürcher Gartenwirtschaften sollen 2020 an ausgewählten Wochenenden zwei Stunden länger öffnen dürfen. Einige Quartiervereine künden bereits erbitterten Widerstand an.
«Mediterrane Nächte» verspricht sich der Zürcher Gemeinderat davon: Einige Zürcher Bars und Restaurants sollen an Sommerwochenenden ihre Gäste zwei Stunden länger draussen bewirten dürfen. Ihren Aussenbereich müssten Bars an der Langstrasse dann beispielsweise erst um 2 Uhr morgens schliessen, wenn dieser heute bis Mitternacht offen ist. Das Stadtparlament hat einen Vorstoss von Nicole Giger (sp.) und Andri Silberschmidt (fdp.), der das aus Thun und anderen Städten bekannte Konzept in Zürich testen will, im Frühling deutlich gutgeheissen. Dagegen waren die AL, die lange Gerichtsverfahren befürchtet, sowie einige Vertreter anderer Parteien, die der Quartierbevölkerung nicht mehr Lärm zumuten wollen.
Das Sicherheitsdepartement hat am Mittwoch im Amtsblatt nun die Eckpunkte dieses Versuchs dargelegt: Die Cafés dürfen nur an jeweils zwei Wochenenden im Sommer 2020 von den längeren Öffnungszeiten profitieren. Die Betriebe in den Stadtkreisen 1, 2 und 8 sind zum Beispiel am 11./12. Juli sowie am 1. und 2. August an der Reihe; die Kreise 3 bis 5 sowie 9 dürfen am 18./19. Juli sowie am 8./9. August länger öffnen, die restlichen Kreise sind nochmals je eine Woche später dran. Man wolle den Versuch wissenschaftlich begleiten und auswerten lassen, schreibt das Sicherheitsdepartement in einer Medienmitteilung.
Der Versuch wird zudem beschränkt auf bestehende Gastwirtschaften mit Aussenbereichen. Restaurants und Bars, die sich in bestimmten lärmempfindlichen Gebieten befinden, dürfen zudem nicht am Pilotversuch teilnehmen. Lautsprecher und Live-Musik sind nicht erlaubt, zudem können Betriebe, bei denen es zu laut wird und die zu wenig dagegen tun, von künftigen mediterranen Nächten ausgeschlossen werden.
Mit diesen Einschränkungen bleibt die Stadt hinter dem Postulat des Gemeinderats zurück. Das kommt nicht ganz unerwartet: Die Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (gp.) hat bereits im Frühling im Rat erwähnt, dass man den Versuch 2020 «vorsichtig angehen» und im Anschluss sauber auswerten werde. Erst danach werde über eine definitive Einführung der «mediterranen Nächte» entschieden.
«Das Mass ist voll»
Gar keine Freude am Versuch, trotz reduziertem Umfang, hat die neue Gruppe «Innenstadt als Wohnquartier». Beteiligt sind unter anderem die Quartier- und Einwohnervereine in der Innenstadt links und rechts der Limmat, in Selnau sowie in Aussersihl-Hard (Kreis 4), hinzu kommt die IG Idaplatz. Das Mass sei voll, schreibt die Gruppe in einer Medienmitteilung. Man werde mit allen Mitteln «– politisch und juristisch – gegen die mediterranen Nächte und gegen den Kommerzialisierungs-, Eventisierungs- und Liberalisierungswahn kämpfen». Die Innenstadtquartiere würden damit als Wohnquartiere infrage gestellt. Die Politik sei sich dessen zu wenig bewusst.
Zudem kündigt sie eine Pressekonferenz an; man sei über den Entscheid nicht vorinformiert und entsprechend überrascht worden. «Wir planen, Rekurs gegen den Versuch einzulegen», sagt Felix Stocker, ehemaliger SP-Gemeinderat und Vertreter der Gruppe. Allerdings müsse man noch gewisse juristische Abklärungen vornehmen. Das Bundesgericht habe 2018 einen Entscheid getroffen, der die Restauration in Innenhöfen einschränkt. «Das nehmen wir uns als Vorbild.»
Mit dem reduzierten, sanften Versuch sei es wohl besser möglich, das Resultat als Erfolg darzustellen, sagt Stocker. «Aber wenn nur punktuell getestet wird, kann man den Versuch gar nicht wissenschaftlich untersuchen.» Völlig unklar sei zudem noch, wie es nach der Testphase weitergehe.
Die «mediterranen Nächte» seien aber bloss Stein des Anstosses, weshalb man die Gruppe gegründet habe. Die Immissionen seien in der Innenstadt jetzt schon sehr gross, sagt Stocker. «Es geht uns darum, diese als Wohnquartier zu erhalten – auch für sensitive Personen wie Ältere und Kinder.» Die Gruppe will sich also langfristig als Stimme in der Nachtlärmdebatte etablieren. Weitere Initiativen seien indes noch nicht spruchreif. Nebst den aufgeführten Vereinen hätten sechs weitere Gruppierungen im Grundsatz ihre Unterstützung gegeben, diese müssten intern aber noch das definitive Okay einholen.
Die Gruppe (sowie Bürgerinnen und Bürger) hat nun dreissig Tage Zeit, gegen den Pilotversuch Einsprache zu erheben.
«Etwas mutlos»
Doch auch die Promotoren der längeren Öffnungszeiten sind nicht restlos zufrieden. Nicole Giger sagt, sie begrüsse, dass etwas umgesetzt werde. Man habe allerdings im Postulat nicht vorgesehen, dass der Versuch auf wenige Wochenenden und Kreise reduziert werde. «Ich finde das schade und etwas mutlos. Ich frage mich, ob sich daraus eine gute Basis für eine verlässliche Auswertung ergibt.» Doch es sei wohl die «typisch schweizerische Art», sich den mediterranen Nächten zu nähern, nämlich über einen Kompromiss.
Andri Silberschmidt ist grundsätzlich zufrieden mit dem Versuch. «Ich bin überzeugt, dass diese Testphase das ‹Schreckpotenzial› der mediterranen Nächte vermindert.» Der Mensch sei bei Neuerungen per se etwas skeptisch. «Für die Akzeptanz ist es daher wichtig, dass wir Schritt für Schritt vorgehen.» Unverständlich findet er die Reaktion der Gegner: «Einige Quartiervereine blockieren die Idee seit Tag 1 komplett.» Es brauche Gesprächsbereitschaft von beiden Seiten. Zürich verändere sich, auch die Quartiervereine müssten mit der Zeit gehen. Im Versuch gehe es ja gerade darum, die Gartenbeizen einzubeziehen, die wegen möglicher Lärmklagen selbst alles Interesse daran hätten, dass sich die Gäste ruhig verhielten.
Stadtrat will Mittelweg gehen
Mathias Ninck, der Sprecher des Sicherheitsdepartements, sagt, dass mit der Beschränkung auf sechs Wochenenden dem Ruhebedürfnis der Anwohner Rechnung getragen werden solle – man habe einen Weg in der Mitte, zwischen den Interessen von Wirten und jenen der Quartierbevölkerung, finden müssen. Sofern es nicht an allen sechs Wochenenden regne, bringe der Versuch auf jeden Fall Erkenntnisse.
Die Überraschung könne er nicht nachvollziehen: «Der Vorstoss wurde im Frühling schliesslich mit grossem Mehr überwiesen.» Aufgrund möglicher Einsprachen und Fristen hätte man den Beschluss nicht erst im Frühling veröffentlichen können. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung würden die verschiedenen Interessengruppen von Beginn weg in den Test einbezogen, sagt Ninck.
Die Vorbereitung und Durchführung des Versuchs werde auf jeden Fall anspruchsvoll: «Jeder Beizer muss ohne grossen Aufwand sehen, ob er seine Öffnungszeiten verlängern darf oder nicht.»