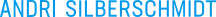am 14. August 2025 als Gastkommentar in der Aargauer Zeitung publiziert
Eine Coiffeuse in Zürich verdient kaufkraftbereinigt rund 50 % mehr als eine in Wien – ebenso der Lehrer im Emmental gegenüber dem Vorarlberg oder die Pflegerin in Lausanne gegenüber Salzburg. Nicht, weil sie schneller arbeiten, sondern weil die Schweiz zu den produktivsten Volkswirtschaften der Welt gehört.
Der Grund für diese Lohnunterschiede ist einfach: Die Schweiz gehört zu den produktivsten Volkswirtschaften der Welt. In Ländern mit hoher Produktivität steigen Löhne und Preise in allen Branchen – auch in lokalen Dienstleistungen. Nicht, weil die Coiffeuse schneller schneidet, sondern weil die gesamte Volkswirtschaft produktiver ist.
Da die Löhne in einem Land nicht völlig auseinanderklaffen, profitieren auch die Coiffeuse in Zürich, die Lehrerin im Emmental und der Pfleger in Lausanne von diesem Produktivitätsvorsprung. Dieser sogenannte Balassa-Samuelson-Effekt zeigt: Der stärkste Hebel für mehr Wohlstand ist die Steigerung der Produktivität – und zwar für alle Branchen.
Der Wohlstand des Schweizer Mittelstandes ist jetzt aber akut in Gefahr. US-Präsident Trump greift produktive Schweizer Branchen an. Sein Ziel ist die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus der Pharma- oder der Maschinenindustrie in die USA. Hat er damit Erfolg, leiden darunter nicht ausschliesslich die betroffenen Firmen und ihre Angestellten, sondern alle in der Schweiz, weil ihre Löhne auch unter Druck kommen.
Statt die Löhne zu stärken, konzentriert sich die Schweizer Politik aber auf den Ausbau des Sozialstaats: 8 Milliarden mehr für die AHV, 36-wöchige Elternzeit oder die Einführung einer 38-Stunden-Woche bei gleichbleibendem Lohn. Alle diese Bestrebungen erhöhen die Abgabenlast und schwächen die Arbeitsanreize. Das Resultat ist verheerend: Sinkt das Produktivitätswachstum bei gleichzeitig steigenden Abgaben, verliert die Kaufkraft gleich doppelt: Unsere Löhne steigen weniger stark, während wir auf diese immer mehr Steuern und Abgaben zahlen müssen.
Wir brauchen einen Kurswechsel: Erstens müssen wir die Bemühungen stoppen, die mit einem Schlag Abgaben erhöhen und die Produktivität schmälern. Gleichzeitig sollten wir konsequent über Steuersenkungen für den arbeitenden Mittelstand sprechen. Dort schlummert enormes Wohlstandspotenzial für alle. Zweitens müssen wir die Produktivität dort fördern, wo dies möglich ist, damit die Löhne überall in der Schweiz steigen.
Arbeit muss sich wieder lohnen
Dabei gibt es zwei Stossrichtungen: Die Individuelle und die Volkswirtschaftliche. Erstens muss es sich für die Menschen in der Schweiz wieder lohnen, mehr zu arbeiten. Mit der Einführung der Individualbesteuerung senken wir die Steuerlast von Ehepaaren und setzen einen liberalen Erwerbsanreiz. Weiter sollen die Betreuungsabzüge erhöht werden, so dass arbeitende Eltern stärker entlastet werden.
Rahmenbedingungen für produktive Jobs schaffen
Zweitens muss die Schweizer Politik Rahmenbedingungen schaffen, damit dort Stellen entstehen, wo die Produktivität hoch ist. Das hat – wir erinnern uns an den Balassa-Samuelson-Effekt – einen direkten, positiven Effekt auf das Einkommen aller Menschen in der Schweiz. Die Lösung: Mehr Unternehmertum wagen! Es beginnt mit der Stärkung des unternehmerischen Denkens und Handelns in der Bildung, geht über eine Vereinfachung der Unternehmensgründung, Kapitalbeschaffung und Anstellung von Personal aus Drittstaaten bis hin zu mehr Freihandelsverträgen und einer Automatisierung und Deregulierung der staatlichen Prozesse.
Der Zollhammer hat viele schockiert – und die Dringlichkeit eines Kurswechsels verdeutlicht. Die Folgen können desaströs sein, wenn nicht jetzt gehandelt wird. Dazu gehört sicherlich, bald eine drastische Senkung der Zölle zu erreichen. Damit ist es aber nicht getan.
Es ist an der Zeit, die Priorität der Schweizer Politik zu ändern: Mehr Fokus auf die Wert-schöpfung, weniger Ablenkung mit neuen Partikularinteressen und Umverteilungsphantasien, die allen teuer zu stehen kommen.
Damit schaffen wir wieder Rahmenbedingungen, dass die Coiffeuse, die Lehrerin und der Pfleger in der Schweiz auch in Zukunft mehr verdienen und sich mehr leisten können, als ihre Berufskollegen im Ausland.