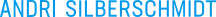Rede zum Nationalfeiertag 2025 – es gilt das gesprochene Wort
Geschätzte Damen und Herren
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Wir feiern heute den Geburtstag der Schweiz. Unseren Nationalfeiertag.
Allein das ist noch nichts Aussergewöhnliches – jedes Land feiert sich einmal im Jahr. Was aber besonders ist: Wie wir diesen Tag feiern – und was wir dabei zum Ausdruck bringen.
1. Die Ausnahme Schweiz
Wir leben in einem Land, das in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme ist – eine glückliche Ausnahme. Nicht nur, weil wir in Sicherheit, Wohlstand und einer intakten Natur leben dürfen. Sondern vor allem, weil wir in einer liberalen Demokratie leben – und das ist weltweit gesehen selten geworden.
Gerade einmal 13 Prozent der Weltbevölkerung leben heute in funktionierenden, liberalen Demokratien. Geschweige denn in eine, direktdemokratischen System wie unserem. Wir sind also nicht die Norm. Wir sind die Ausnahme. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir begreifen, was unsere direkte Demokratie braucht, damit sie auch in Zukunft funktioniert.
2. Die Dorfdemokratie
Heute, hier, versammeln wir uns im Dorf. Auf Festbänken. Von Mensch zu Mensch. Wir diskutieren, wir feiern, wir hören einander zu. Dieser Austausch – direkt, unverstellt, offen – ist gelebte Demokratie. Ich nenne sie Dorfdemokratie.
Denn Demokratie beginnt nicht in Bern, sondern auf dem Dorfplatz. In der Familie, in der Nachbarschaft, im Verein. Sie lebt von der Diskussion – und davon, dass jede und jeder seine Meinung sagen darf und auch dafür geradesteht. Das erzeugt Respekt und verhindert Extreme.
Lebhafte Debatten sorgen für ein Verständnis der anderen Meinung und führen zu ausgewogenen Lösungen. Man geht gemeinsam ein Bier trinken, auch wenn man sich nicht einig wurde. Die Dorfdemokratie führt zu einem friedlichen Zusammenleben.
Diese Dorfdemokratie hat in den letzten Jahren Konkurrenz bekommen: Die Online-Demokratie. Diskussionen finden heute zunehmend im Internet statt. Nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, sondern von Account zu Account. Und das oft anonym. Oder gesteuert und befeuert durch Algorithmen, durch Maschinen, vielleicht sogar durch ausländische Staaten.
3. Die Herausforderung der Online-Demokratie
Im Netz zählt nicht die durchdachteste oder vernünftigste Meinung. Es zählt, was Klicks generiert, was polarisiert und was Empörung auslöst. Wieso? Weil Klicks für die Plattformen Geld bringt. Ihr Geschäftsmodell basiert auf Aufmerksamkeit und nicht auf Wahrheit oder Dialog.
Ich sage das nicht als Technikfeind oder Antikapitalist. Im Gegenteil. Ich befürworte Fortschritt.
Und glauben Sie mir: Als Liberaler bin ich weit davon entfernt, etwas gegen das Geldverdienen zu haben. Ich bin überzeugt, dass eine Wirtschaft nur dann funktionieren kann, wenn Unternehmen erfolgreich sind, Gewinne erzielen und diese wiederum in Innovation und Wachstum investieren können. Eine florierende Wirtschaft ist die Grundlage für sozialen Ausgleich, Fortschritt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Doch ich werde hellhörig, wenn plötzlich auch mit der Demokratie Gewinne erzielt werden. Welche Interessen treten dann in den Vordergrund? Welche Stimmen erhalten Gehör – nur noch jene, die Klicks generieren? Und wessen Meinungen sind das eigentlich? Wer steht dahinter? Welche Ziele verfolgen diese Akteure?
Demokratie darf kein Geschäftsmodell sein. Denn sobald Profit wichtiger wird als der Diskurs, ist unsere Demokratie in Gefahr.
Und diese Gefahr ist real. Wer kontrolliert, was uns online gezeigt wird? Wer entscheidet, welche Meinung sichtbar wird – und welche nicht? Und was passiert, wenn Maschinen die Diskussion dominieren – oder gar manipulieren?
Auf all diese Fragen haben wir heute nur wenige Antworten. Aber sie sind zentral, wenn wir die demokratische Meinungsbildung und den gesellschaftlichen Diskurs vor einer Aushöhlung durch Maschinen und Bots bewahren wollen.
4. Die vergessene digitale Souveränität
Am 1. August wird oft von Souveränität gesprochen. Von politischer, wirtschaftlicher, manchmal auch Ernährungssouveränität. Aber kaum je von digitaler Souveränität.
Dabei sind wir digital alles andere als souverän. Sie alle besitzen vermutlich ein digitales Gerät – sei es ein Smartphone, ein Laptop oder ein Fernseher. Und in den allermeisten Fällen stammt die Software aus den USA und das Gerät aus Asien. Unsere digitale Infrastruktur ist somit vollständig von ausländischen Staaten und Konzernen abhängig.
Diese Abhängigkeit bleibt nicht ohne Folgen. Was nützt uns ein voller Kühlschrank (in Anspielung auf die Ernährungssouveränität), wenn das Stromnetz lahmgelegt wird? Ein solches Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen – die Bedrohung durch koordinierte Cyberangriffe auf die Schweiz ist real und zunehmend wahrscheinlich.
Digitale Souveränität ist daher nicht nur ein technisches Anliegen oder eine Frage des Komforts. Sie betrifft unsere Sicherheit – und unsere Demokratie. Denn der demokratische Diskurs findet heute mehrheitlich auf Plattformen statt, die weder in der Schweiz entwickelt wurden noch hier kontrolliert werden.
Muss das so bleiben? Ich glaube nicht. Wenn wir souveräner werden wollen, müssen wir auch den digitalen Raum mitdenken. Mir ist dabei klar, dass wir als kleine Nation nicht autark werden können – in wohl keinem Bereich. Aber wir werden widerstandsfähiger, wenn wir mehr Dienstleistungen und Produkte aus der Schweiz heraus produzieren.
5. Die Schweiz und Europa können mehr – wenn wir wollen
Es gibt Hoffnung. Wir sind nicht machtlos.
Wir in der Schweiz sind ein Volk der Tüftler, Denker und Pioniere. Das Internet (World Wide Web) wurde in Genf entwickelt. Die Programmiersprache Python stammt aus Europa. Und unzählige weitere Errungenschaften, die heute weltweit verwendet werden, haben hier ihren Ursprung. Doch die grossen Durchbrüche und die wirtschaftliche Verwertung dieser Innovationen fanden dann oft in den USA statt.
Trotz einer grösseren Bevölkerung in Europa wandert ein erheblicher Teil der Wertschöpfung heute über den Atlantik. Das Zentrum der modernen Datenökonomie liegt nicht bei uns. Und es stellt sich die Frage: Haben wir unsere digitale Zukunft längst aus der Hand gegeben? Ist es nicht eine neue Form des Kolonialismus – einer, der nicht mit Armeen kommt, sondern mit Algorithmen? Wer die Daten besitzt, kontrolliert die Narrative, die Märkte, die Menschen.
Unsere digitalen Spuren, gesammelt in der Schweiz, gespeichert und verwertet in Kalifornien – und wir? Wir profitieren zu wenig. Während wir uns in langen Debatten über neue Gesetze verlieren, diskutieren wir kaum über etwas mit mehr Tragweite: Unsere digitale Souveränität.
Oft wird gesagt, die europäische Regulierung sei zu streng. Sie sei der Grund, weshalb in den USA mehr Innovationen entstünden. Doch amerikanische Firmen halten sich längst an unsere Regeln – und trotzdem dominieren sie unsere Märkte. Es kann also nicht nur an der Regulierung liegen. Und ohnehin ist es immer bequem, den Fehler bei den anderen zu suchen.
Ich bin überzeugt: Die Gründe liegen tiefer. Während in den USA und in China nationale Interessen konsequent verfolgt und verteidigt werden, scheint uns in Europa und in der Schweiz das Denken in strategischen Interessen abhandengekommen zu sein. Dabei müssten wir uns gerade heute fragen: Welche Interessen vertreten wir im digitalen Zeitalter?
Ein kleiner Schritt wäre bereits, dass sich unsere Verwaltung mehr für Softwarelösungen aus Genf oder Zürich und weniger aus dem Silicon Valley entscheidet. Denn jede E-Mail, jede Behördendatei, die unverschlüsselt und ausserhalb der Schweiz gespeichert wird, ist ein Risiko.
Doch mit besserer Regulierung allein werden wir dieses Problem nicht lösen. Es braucht einen Mentalitätswandel.
Wir müssen vermehrt Schweizer und europäische Technologien einkaufen, gerade im öffentlichen Bereich. Denn was ist die Folge, wenn Start-ups aus der Schweiz kein Vertrauen, keine Aufträge, kein Kapital erhalten? Sie verschwinden – oder sie werden verkauft und werden erst dann interessant, wenn sie ein US-Konzern gekauft hat.
Wir brauchen mehr Mut, an eigene Innovationen zu glauben. Mut, auch unausgereifte Ideen zu unterstützen. Mut, unternehmerisches Risiko zu honorieren – statt es zu meiden. Und vielleicht auch den Mut, einen kleinen Teil unseres Vermögens nicht nur auf dem Sparkonto zu parkieren, sondern in die Ideen von morgen zu investieren.
Denn das ist einer der grossen Unterschiede zu Amerika: Dort lebt die Innovationskraft auch vom Kapital der Bürgerinnen und Bürger. Bei uns dominiert hingegen die Sparkonto-Logik.
6. Den Wohlstand von morgen sichern
Was hat das alles mit dem 1. August zu tun? Wir feiern an diesem Tag unsere Heimat, unsere Freiheit, unsere einzigartige Natur. Aber auch unseren Wohlstand – ein Wohlstand, der nur deshalb möglich ist, weil unsere Demokratie funktioniert. Eine Demokratie, die auf Menschen baut, nicht auf Bots. Auf echte Beteiligung, nicht auf datengetriebene Manipulation.
Und diese Demokratie – sie ist auf Innovation angewiesen. Auf unternehmerisches Denken. Stellen wir uns vor, eine global führende KI-Plattform würde in der Schweiz entwickelt, finanziert und betrieben. Unser Land wäre nicht nur wirtschaftlich stark, sondern auch geopolitisch relevant – weil wir Schlüsseltechnologien hätten, die weltweit gebraucht würden.
Wenn wir also über die Sicherheit und Stärke der Schweiz sprechen, dann dürfen wir nicht nur über Armee und Diplomatie sprechen. Wir müssen auch über Unternehmertum sprechen. Denn technologische Souveränität ist wirtschaftliche Souveränität – und diese wiederum ist politische Handlungsfähigkeit.
Deshalb, geschätzte Damen und Herren: Lasst uns das Unternehmertum wieder feiern. Menschen, die etwas wagen. Die Lehrlinge ausbilden. Familienbetriebe weiterführen. Oder während des Studiums ein Unternehmen gründen. Sie alle sind das Fundament unseres Wohlstandes.
Heute jedoch erleben viele Gründerinnen und Gründer Misstrauen statt Rückenwind. Wer erfolgreich ist, wird kritisch beäugt. Wer scheitert, wird gemieden. Und in der Politik scheint für jedes Problem nur eine Lösung denkbar: Noch mehr Staat, noch mehr Steuern.
Doch so kommen wir nicht weiter. So verlieren wir nicht nur unsere digitale Souveränität – wir verlieren auch unsere wirtschaftliche Basis. Natürlich: Die Wirtschaft ist nicht alles. Aber ohne wirtschaftliche Grundlage ist alles andere nichts.
Wenn wir also heute die Schweiz feiern, dann sollten wir auch jene Menschen feiern, die etwas erschaffen – und jene Ideen, die morgen unsere neuen Nestlés, Migros oder Roche entstehen lassen könnten. Denn wie der Fall der Credit Suisse zeigt: Erfolg ist nie garantiert. Umso mehr müssen wir jetzt investieren – in die nächsten Generationen von Schweizer Unternehmen.
Zurück zur Dorfdemokratie: Unsere Stärke liegt im Miteinander. In geteilten Werten. In Leistungsbereitschaft, die auch Schwächeren ein gutes Leben ermöglicht. Diese Werte sind nicht altmodisch – sie sind unsere Zukunft.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nationalfeiertag – und den Mut, die Schweiz von morgen mitzugestalten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.